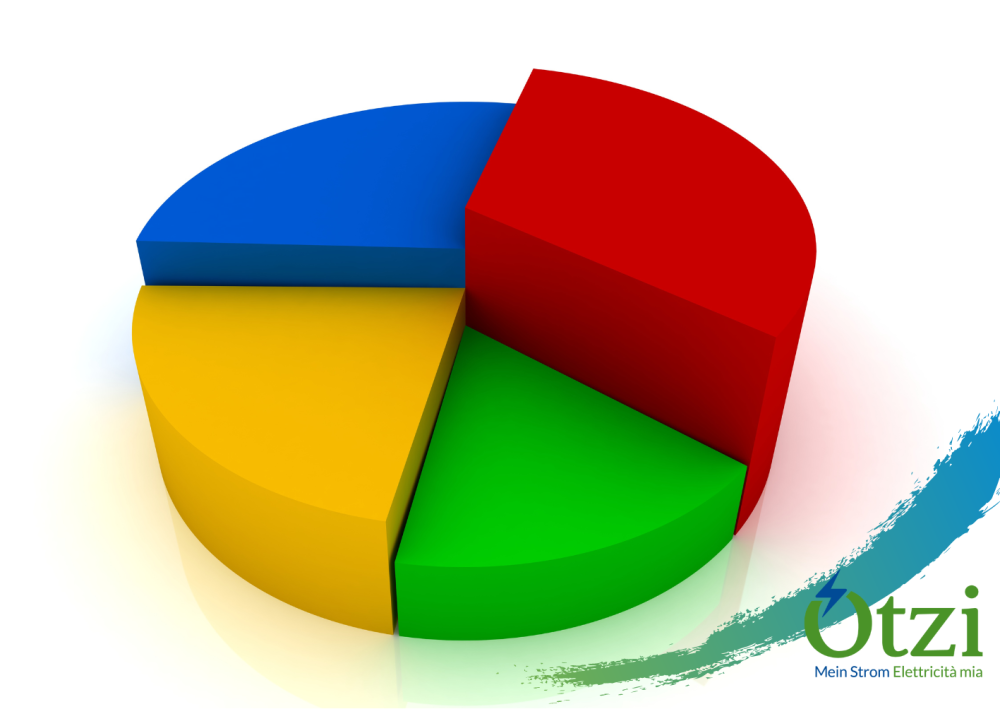Als „schwimmende Photovoltaik“ werden Photovoltaik-Kraftwerke auf Gewässern bezeichnet, deren Module auf Schwimmkörpern montiert sind. Verankert sind die Anlagen am Ufer oder am Gewässergrund. Aufgrund der natürlichen Modulkühlung durch das Wasser arbeiten diese „Floating Photovoltaics“ deutlich effizienter als konventionelle Freiflächenanlagen. Ein weiterer Vorteil: Schwimmende Photovoltaik-Anlagen verringern die Verdunstung auf der von ihnen bedeckten Wasserfläche – und zwar ganz besonders in den heißen Wüstenregionen auf der Südhalbkugel. Ein internationales Forschungsteam hat diese Aussagen in einer neuen Studie bestätigt.
Als Fallbeispiele dienten dabei der Nasser-See in Ägypten und der Nubia-See im Sudan, die in den 1960er Jahren durch den Bau des Assuan-Staudamms entlang des Nils in beiden Staaten entstanden sind (Evaporation reduction and energy generation potential using floating photovoltaic power plants on the Aswan High Dam Reservoir). Es handelt sich dabei um eine 6.000 Quadratkilometer große Wasserfläche mit 169 Milliarden Kubikmetern Wasser. Die Forschungsergebnisse unterstreichen das enormene Potential der Photovoltaik-Technologie auf diesen beiden künstlichen Seen. Die Forscherinnen und Forscher haben die Auswirkungen schwimmender Photovoltaik-Kraftwerke unterschiedlicher Größen für die Jahre 2005 bis 2016 berechnet. Wenn man in diesem Zeitraum auf zehn Prozent der Wasserfläche schwimmende Photovoltaik-Module installiert hätte, wäre der Wasserverlust durch die Verdunstung um 7,2 Milliarden Kubimeter gesunken, bei ener 90prozentigen Abdeckung der Seen steigt diese Zahl auf 70,4 Milliarden Kubikmeter.
Erstaunlich sind auch die Berechnungen der Stromproduktion: Mit einem Solarkraftwerk, das nur zehn Prozent der gigantischen Wasserfläche nutzt, könnte Ägypten 95 Prozent seines eigenen Bedarfs an elektrischer Energie erzeugen. Würde das Solarkraftwerk auf 50 Prozent der Fläche der Seen errichtet, könnte die Stromproduktion sogar den Bedarf des gesamten afrikanischen Kontinents (715 Terawattstunden) abdecken.