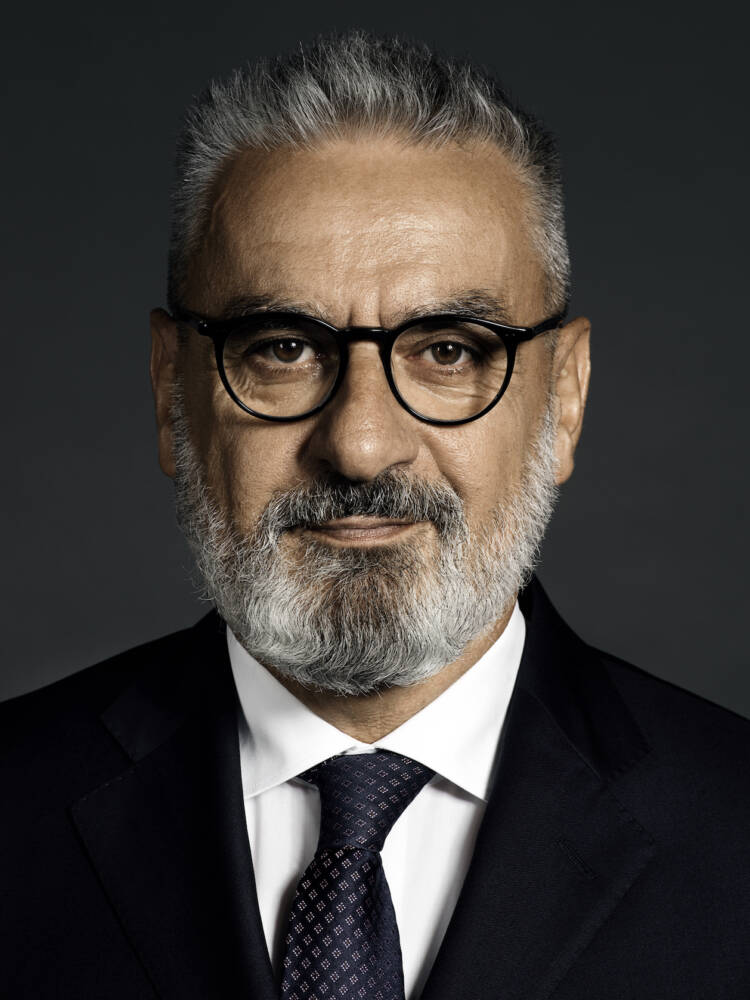Dr. Uta Eser ist Biologin und Umweltethikerin und erforscht unter anderem den Zusammenhang zwischen Politik, Ethik und Ökologie.
Ötzi Strom hatte die Ehre Ihr einige Fragen zu stellen:
Viele Menschen erklären, dass ihnen der Schutz der Natur wichtig sei. Gleichzeitig tragen sie – etwa mit ihrem Konsum – zu deren Zerstörung bei. Auch Naturschützer haben Handys, fahren Auto, benutzen Computer und kaufen Bitcoins. Wie lässt sich dieser Widerspruch lösen?
Diesen Widerspruch auf der individuellen Ebene zu lösen, ist kaum möglich. „Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach“ – das gilt ja nicht nur beim Klima, sondern beispielsweise auch für die individuelle Gesundheitsvorsorge. Solange klimaverträgliche Handlungsmuster billiger und bequemer sind als klimaschädliche, wird es kaum gelingen, hinreichend viele Menschen zum Umsteigen zu bewegen.
Ist ein „naturnahes“ Leben ohne den Verbrauch wertvoller Ressourcen in unserer modernen und technisierten Welt überhaupt möglich?
Grundsätzlicher gefragt: Kann der Mensch – als vernunftbegabtes und „wissendes“ Wesen – aufgrund seiner Sonderstellung in der Evolution überhaupt „natürlich“, naturnah oder im Einklang mit der Natur leben?
Ich halte wenig davon, hier allgemein von „der Mensch“ zu sprechen. Naturzerstörung ist keine biologische Eigenschaft der menschlichen Gattung, sondern die Folge einer Lebens- und Wirtschaftsweise, die den Eigennutz zum allein gültigen Kriterium erhebt. Es gab und gibt viele Menschen auf der Erde, die Rücksichtnahme auf die Natur üben.
Geht es beim Naturschutz nicht immer auch um den Menschen selbst? Anders gefragt: Setzen wir uns nicht vor allem deshalb zum Schutz der Natur ein, weil es uns nutzt?
Selbstverständlich geht es auch um den Menschen – wir sind ja schließlich Teil der Natur. Und was soll an der Sorge um uns selbst falsch sein? Allerdings halte ich es für zu kurz gegriffen, nur über den Nutzen der Natur zu sprechen. Viele Menschen schützen Natur auch, weil sie sie achten, verehren oder lieben – das ist etwas ganz anderes als ein Nutzungsinteresse.
Würde jemand gegen die Abholzung der Regenwälder oder die Verschmutzung der Meere protestieren, wenn das keine Folgen oder sogar positive Folgen hätte?
Das weiß ich nicht – und ich finde es auch müßig darüber zu spekulieren. Wir wissen ja, dass es negative Folgen gibt, für Menschen, Tiere und Ökosysteme. Das genügt doch.
Ist die Nutzung erneuerbarer Energieträger wie Wasser, Sonne oder Wind ein Mittel zum Zweck – oder kann das ein Schritt zu einer Koexistenz mit Natur werden, die auf Zerstörung und Ausbeutung – auch des Menschen selbst – verzichtet?
Machen wir uns nichts vor – auch die Nutzung erneuerbarer Energieträger hat ihren Preis für die Natur. Die Umstellung auf Erneuerbare ist zwar nötig, aber nicht hinreichend. Eine ernsthafte Wende wird es erst geben können durch eine Politik der Suffizienz. Wir müssen nicht nur andere Energieträger verwenden, sondern unseren Energiebedarf insgesamt reduzieren.