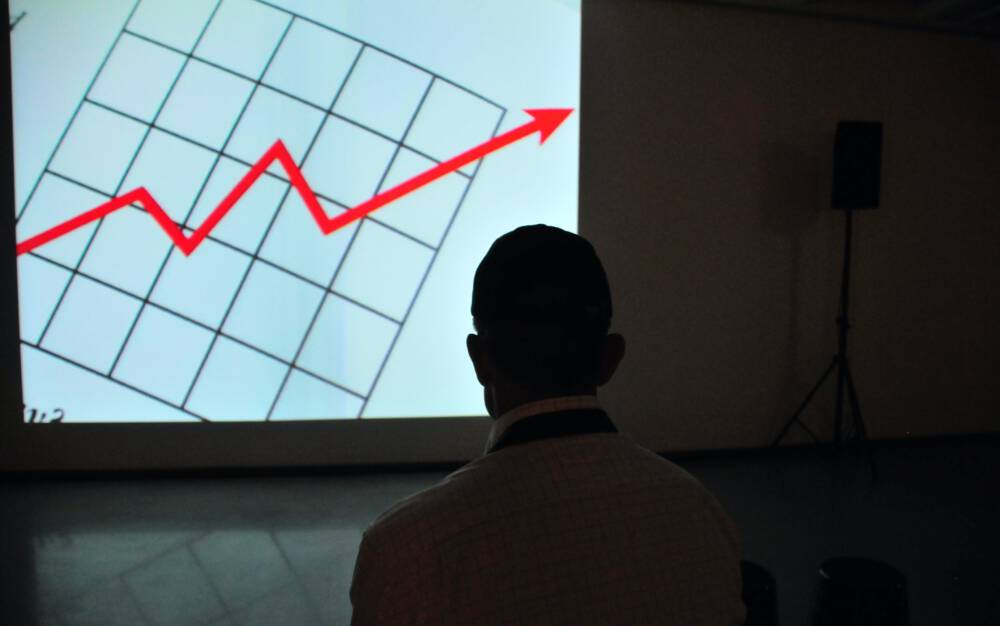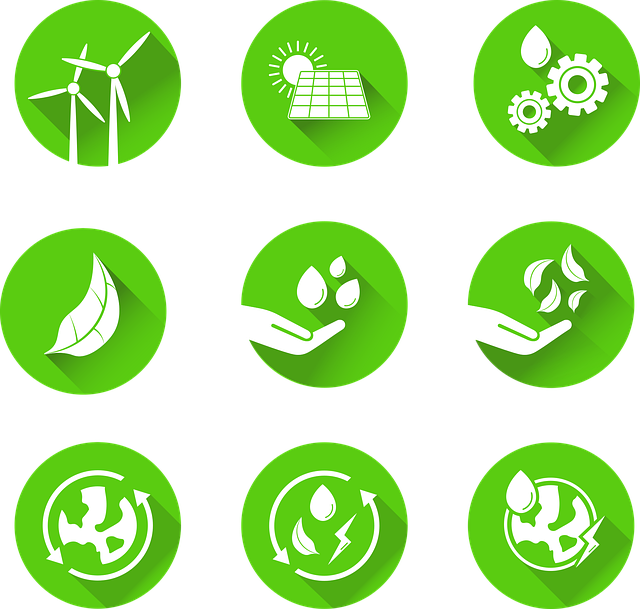Energieautonomie lohnt sich – auch im Bereich der Wärmeversorgung. Wenn es um grüne und kostengünstige Fernwärme geht, sind Fernheizsysteme heute die erste Wahl. Mit 78 Anlagen verfügt Südtirol heute über die höchste Konzentration von Biomasse-Fernheizwerken in Italien. Mehr als 17.000 Südtiroler Haushalte werden mit „Fernwärme versorgt. Während die Öl- und Gaspreise rasant steigen, sind die Einkaufspreise für Hackschnitzel oder Rundholz in einem geringeren Ausmaß gestiegen.
Neue Technologien verstärken diesen großen Preisvorteil: 2021 baut das Heizwerk Toblach-Innichen ein neues Heizhaus. Mit einer an zwei Heizkesseln betriebenen ORC-Anlage produziert der Betrieb den Strom für den Eigenbedarf seitdem zu 100 Prozent selbst und verkauft seinen Überschussstrom an ein lokales Energieversorgungsunternehmen. Deshalb kann die Betreibergenossenschaft ihre Lieferpreise für 2.000 lokale Haushalte und Unternehmen 2022 von 0,092 Euro pro Kilowattstunde – ein Wert, der seit 1994 unverändert geblieben war – auf 0,085 Euro senken.
Übrigens: In ihrer Richtlinie über die Förderung und Ausbau erneuerbarer Energie unterstreicht die EU „dass sich Endkunden und insbesondere Haushalte, unter Beibehaltung ihrer Rechte oder Pflichten als Endkunden, an einer Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft beteiligen dürfen“. Mit dem Aufbau genossenschaftlicher Fernheizwerkbetreibe hat man das in vielen Südtiroler Dörfern schon vor Jahrzehnten in Eigeninitiative getan – ohne EU, ohne Clean Energy Packages, ohne Klimapläne aus Bozen und Rom. „Ökologische Selbstversorgung? Warum eigentlich nicht – wenn die Voraussetzungen dafür bestehen. Die Produktion und die Verteilung von Energie werden damit zu einem zentralen Bestandteil lokal verwurzelter und regional eng vernetzter Wirtschaftskreisläufe. Auch das ist Autonomie – und Unabhängigkeit“ – diese Sätze hat der Südtiroler Energieverband 2012 – also vor zehn Jahren – in seinen energiepolitischen Thesen formuliert und daran hat sich bis heute nichts geändert.