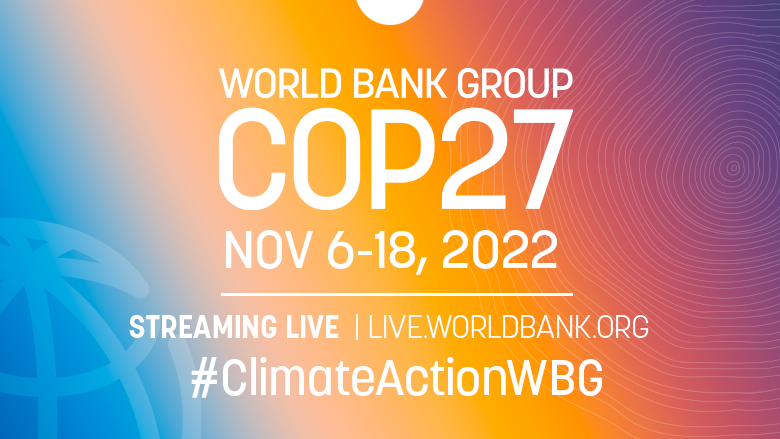Italiens neuer „Piano Mattei per l’Africa“. Giorgia Meloni reiste nach Algerien. Dort kündigte sie an, Italien zu einem europäischen Knotenpunkt für Energielieferungen aus dem afrikanischen Kontinent machen zu wollen. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist Algerien der wichtigste Gaslieferant für Italien. Das Land hat 1987 seine Gasfelder eröffnet und diese in den Folgejahren die Transmed-Pipeline erweitert. Diese ist heute direkt mit der Poebene verbunden.
Die To-Do-Liste der Energiekonzerne ENI (Italien) und Sonatrach (Algerien) ist durchaus ambitioniert. Sie wollen in den kommenden Jahren die Lieferung von fossilem Gas aus der algerischen Wüste potenzieren. Zudem ist auch eine Pipelineverbindung für den Transport von „grünem“ Wasserstoff geplant. Die Energie aus den Solarkraftwerden soll diesen Wasserstoff produzieren. In den kommenden Monaten will die italienische Regierung die Kontakte mit weiteren afrikanischen Energiexporteuren intensivieren. Der Kontakt zu Libyen, Ägypten, Marokko oder Nigeria soll ausgebaut werden. Kurz gesagt: Das Land verschiebt die Lieferketten für Energieeinfuhren von einer West-Ost- auf eine Nord-Süd-Achse und bezieht sich gleichzeitig auf das Erbe des legendären ENI-Gründers Enrico Mattei.
Eine bessere Visitenkarte ist in Nordafrika wohl kaum vorstellbar. Mattei, nach dem in Algier ein – von Giorgia Meloni während ihres Aufenthalts besuchter – Park benannt ist, bot den afrikanischen Öl- und Gasförderländern Ende der 1950er und Anfang der 1960er Jahre überaus vorteilhafte Bedingungen an – und schuf damit eine Alternative zur Geschäftspolitik der multinationalen Energiekonzerne Exxon, Mobil, Texaco, Standard Oil of California, Gulf Oil, Royal Dutch Shell und British Petroleum. Laut Mattei betrachteten diese Unternehmen die globalen Energiemärkte als „Jagdrevier für ihre Monopolpolitik“. Der ENI-Präsident garantierte den afrikanischen Staaten 75 Prozent der mit ihren Rohstoffen erzielten Gewinne und hob die damit bis dahin geltende 50:50-Aufteilung zwischen Ölgesellschaften und Förderländern auf. Die Zukunft wird zeigen, ob die italienische Regierung den antikolonialistischen Ansatz des ENI-Generals fortsetzt, der politische Parteien einmal als „Taxi“ beschrieben hatte: „Ich steige ein, ich zahle und wenn ich einmal an meinem Ziel angekommen bin, steige ich wieder aus“.